Gemeinsam den Weg zu intuitivem Essen bei Kindern beschreiten
Von Geburt an besitzen Kinder eine natürliche Fähigkeit, Hunger und Sättigung zu erkennen, eine Form der Körperintelligenz, die jedoch oft durch zu strenge Ernährungsregeln der Eltern verloren geht. confidimus ist es wichtig, die innere Stimme des Kindes über gesellschaftliche Ernährungsnormen zu stellen.
Die Gründerinnen und ihre Partnerinnen vermitteln Familien, dem natürlichen Ernährungskompass ihrer Kinder zu vertrauen und ihn zu fördern, um eine lebenslange, gesunde Beziehung zum Essen zu ermöglichen, basierend auf dem individuellen Körpergefühl beim Essen.
Das neue Buch der confidimus-Gründerinnen

Ab heute nur noch zuckerfreu – Denn nicht der Zucker ist das Problem, sondern unser Umgang mit ihm
Oft steuern wir als Eltern mit einem mulmigen Gefühl auf die Supermarktkasse zu. Kein Ort birgt so viel Potenzial für einen Wutanfall wie dieser. Während du Tiefkühlgemüse, den 2-Kilo-Sack Äpfel und die Vollkornnudeln auf das Band hievst, kullern bei deinem Kind die Tränen, weil du die Frage »Mama, darf ich mir was Süßes aussuchen?« mit einem strengen »Nein!« beantwortest. Momente wie diese gehören bald der Vergangenheit an. Süßigkeiten werden weniger interessant, weil sie nicht mehr verknappt werden und weil dein Kind lernt: Wenn ich es brauche, dann darf ich es haben.
»Eines der wichtigsten Bücher zum Thema Kinderernährung.«
Thomas Frankenbach, Autor, Gesundheits- und Ernährungswissenschaftler und wissenschaftlicher Leiter der Fuldaer Akademie für Gesundheit und Entwicklung
Das Buch zum confidimus-Prinzip
Dein Kind isst besser, als du denkst!
Von Geburt an haben Kinder ein natürliches Gespür für Hunger, Sättigung, Appetit und Bekömmlichkeit. Doch viel zu häufig bringen starre Ernährungsregeln diesen inneren Kompass aus dem Gleichgewicht. Was dabei oft nicht mehr gesehen wird, sind die körperlichen und seelischen Bedürfnisse von Kindern. Dass kleine Esser Lebensmittel ablehnen oder sich phasenweise einseitig ernähren, ist meist entwicklungsbedingt. Indem Eltern ihre Kinder hier vertrauensvoll und achtsam begleiten, helfen sie ihnen, langfristig ein entspanntes Verhältnis zum Essen zu entwickeln.
Dieser wegweisende Ratgeber
-
klärt über verbreitete Denkfehler beim Essen auf
-
beantwortet häufig gestellte Eltern-Fragen
-
zeigt Wege im Umgang mit emotionalem Essen auf
-
bietet Übungen für herausfordernde Situationen im Alltag
-
bestärkt Mütter und Väter in der Wahrnehmung ihrer Kinder
“Dieses Buch kann vielen Eltern wieder zu mehr Gelassenheit in einer Welt des Nahrungsüberschusses und der Normtabellen verhelfen.”
Dr. med. Christian Henkel, Kinderarzt und Therapeut für frühkindliche Essverhaltensstörungen
Bekannt aus 

 und weiteren Medien
und weiteren Medien

Das confidimus Familientagebuch
Das confidimus Familientagebuch ist nun verfügbar! Dieses 12-Wochen-Tagebuch bietet Eltern, die nach dem confidimus-Prinzip leben möchten, zusätzliche Unterstützung.
Wir neigen oft dazu, die Dinge eher kritisch zu sehen: 100 Dinge klappen gut und die eine Sache, die schief läuft, bleibt im Gedächtnis. Das confidimus-Familientagebuch hilft dir als Elternteil dabei, den Fokus auf das Gute zu legen, auf das, was schon sehr gut klappt. Gleichzeitig soll es dir helfen, hinzusehen – und zu erkennen, an welchen Stellen es noch nicht so klappt, wie ihr es euch als Familie wünschen würdet. Dafür möchten wir die mit diesem Familientagebuch Raum zur Reflexion geben.
Es hilft, den Fokus auf positive Aspekte der gemeinsamen Mahlzeiten am Familientisch zu legen und Bereiche zu identifizieren, die Verbesserung benötigen. Mit täglichen Reflexionsfragen und wöchentlichen Themenfeldern unterstützt es Familien dabei, das confidimus-Prinzip fest in ihren Alltag zu integrieren und einen unbeschwerten Familientisch zu fördern.
Wir wünschen uns, dass Familien mithilfe des Tagebuchs das confidimus-Prinzip wunderbar in ihrem Alltag verankern können, damit einem unbeschwerten Familientisch nichts mehr im Wege steht...

Das confidimus-Erwachsenentagebuch
Das confidimus-Erwachsenentagebuch wurde entwickelt, um Erwachsene dabei zu unterstützen, hinderliche Muster aus der Kindheit zu durchbrechen und bewusst essen zu lernen. Es fördert langfristige Verhaltensänderungen durch das Bewusstmachen und Trainieren neuer, gesünderer Essgewohnheiten. Dieses Tagebuch hilft dabei, die Kontrolle über das eigene Essverhalten zurückzugewinnen und mehr Vertrauen in die eigenen Körpersignale zu setzen, was essentiell ist, um bewusst essen zu praktizieren. Es dient als stetiger Begleiter auf dem Weg zu einem unbeschwerten Essverhalten.
Langfristige Verhaltensänderungen sind nicht ganz einfach zu erreichen. Unser Gehirn ist in der Lage, Muster zu etablieren – und das ist in vielerlei Hinsicht für uns sehr hilfreich. Die meisten Dinge, die wir täglich tun, laufen quasi automatisch ab. Leider ist dies auch bei den Dingen der Fall, die uns vielleicht nicht guttun oder die sogar hinderlich für uns sind. Wollen wir uns also besser fühlen, müssen wir diese Muster durchbrechen.
Spannend ist, dass unser Gehirn über die sogenannte Neuroplastizität verfügt und damit in der Lage ist, Neues zu lernen und zu verankern. Dies benötigt jedoch Training – vergleichbar mit dem Bauch- oder Oberarmtraining. Eine Trainingseinheit reicht nicht aus, um ein Sixpack zu bekommen.
Deshalb braucht auch der Weg zu einem unbeschwerten Essverhalten kontinuierlich Übung. Zunächst findest du mit deinem confidimus-Erwachsenentagebuch heraus, welche Routinen für dich hinderlich sind. Und dann: üben, üben, üben! Im Laufe von 12 Wochen unterstützt dich das confidimus-Erwachsenentagebuch dabei auf wunderbare Weise.
Nach drei Monaten werden deine neuen, hilfreichen Muster in puncto Essverhalten so stark sein, dass du ohne Unterstützung weitermachen kannst – und einem unbeschwerten Essverhalten damit nichts mehr im Wege steht.

Angebote für Eltern

Kostenfreie Telefonberatung
ob unser Angebot das Richtige für Sie ist
Preis: € 0

confidimus-Einzelcoaching
Dauer: 90 Minuten
Preis: € 149,-

confidimus-Coachingpaket
3 confidimus-Coachings à 90 Minuten
Preis: € 499,- (Sie sparen € 80,-)
Das sind wir…
Julia Litschko und Katharina Fantl
Coaching, Mediation, Ernährungstraining für Somatische Intelligenz und Kommunikation – aber vor allem sind wir Mütter von insgesamt vier Jungs. Wir haben lange selbst darunter gelitten, dass unsere Kinder nicht so gegessen haben, wie es die Ernährungspyramide vorgibt. Wir haben Kämpfe am Esstisch geführt, haben uns Sorgen gemacht und versucht, mit einem festen Regelwerk einen Ausweg zu finden. Dabei haben wir oft gespürt: Dieser Weg kann nicht richtig sein. Unsere Kinder sollten frei, ungezwungen und selbstbestimmt essen dürfen. Also haben wir eines getan: Wir haben uns der Ernährungsberatung für Kinder gewidmet, dabei unsere Denkmuster gekippt und etwas Neues gewagt. Entstanden ist daraus das confidimus-Prinzip, denn so wie wir leiden viele Eltern unter dem Stress, ein Kind tagein tagaus gesund zu ernähren. Wir entwickelten auf unserem Weg nicht nur ein innovatives Coachingkonzept, sondern befragten darüber hinaus ausgewiesene Experten zum Thema, arbeiteten intensiv mit Eltern, schrieben zwei Bücher und bildeten ein starkes Netzwerk von qualifizierten Partnerinnen, die heute mit uns gemeinsam das confidimus-Prinzip in die Welt tragen. Wir sind viele! Und uns alle verbindet das Ziel, unseren Ansatz der Ernährungsberatung in die Familien zu tragen: Wir möchten Eltern die Ernährungssorgen nehmen und Kindern so zu einem lebenslang natürlichen Essverhalten verhelfen. Dafür setzen wir uns täglich ein.

... Und wir sind viele
Ärzte, Therapeuten und weitere Experten unterstützen unsere Arbeit
Ich unterstütze confidimus, weil ich den Ansatz für bedeutungsvoll halte. Denn er nimmt Eltern den Stress beim Thema Ernährung – und sie werden gestärkt, so zu leben, einzukaufen, zu kochen und zu essen, wie es ihnen intuitiv richtig erscheint. Für sich selbst. Und für ihre Kinder.
In schwierigen Fällen von Essstörungen oder Sondenabhängigkeit empfehlen wir die Behandlung durch ein spezialisiertes Team. Bei Fragen wenden Sie sich an » NoTube.
Univ.-Prof. Dr. med.
Marguerite Dunitz-Scheer
Fachärztin für Kinderheilkunde und Kinder- und Jugendpsychotherapeutin
Für eine vermeintlich gesunde Ernährungsweise liegen keine wissenschaftlichen Belege, keine Kausalevidenzen vor. Ergo, worauf „hören“, wenn nicht auf Regeln? Ganz einfach: Die individuelle Körperintelligenz ist unser wichtigster Ernährungskompass und ich freue mich, dass dieses Thema nun direkt in die Familien getragen wird.
Uwe Knop
Diplom-Ernährungswissenschaftler, Medizin-PR-Experte & Autor
Ursache der meisten Ernährungsprobleme ist eine verminderte Körperwahrnehmung. Gezielt das Körpergefühl zu trainieren ist oft die wirksamste Therapie.
Thomas Frankenbach
Autor, Gesundheits- und Ernährungswissenschaftler und wissenschaftlicher Leiter der Fuldaer Akademie für Gesundheit und Entwicklung
Kognitive Kontrolle des Essverhaltens verstärkt die Tendenz zu Übergewicht und Essstörungen. Das Gegenteil von dem, was wir eigentlich damit beabsichtigen.
Dr. med. Dagmar Pauli
Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie Zürich
Die richtige Ernährung bei Kindern ist individuell.
Der menschliche Körper ist in puncto Ernährung ein wahres Wunderwerk: Hunger, Sättigung und Bekömmlichkeit sind perfekt aufeinander abgestimmt und funktionieren ganz intuitiv. Oftmals sind diese Mechanismen bei Erwachsenen durch Diäten und Empfehlungen für eine vermeintlich gesunde Ernährung aus der Balance geraten. Kinder aber haben ein feines Gespür für ihre Körpersignale und wissen intuitiv, welches Essen gesund für sie ist – wenn wir sie darin bestärken, ihrer Körperintelligenz zu folgen. Doch in einer komplexen Welt ist es oft nicht leicht, dieses Vertrauen zu schenken. Zu stark sind die Einflüsse von außen, zu groß ist der Druck, den Kindern die Bedeutung einer gesunden Ernährung zu vermitteln.
Unser confidimus-Prinzip basiert auf drei Säulen

Stärkung der Körperintelligenz
Es gibt viele Gründe, warum Kinder beim Essen nicht mehr ihrer natürlichen Körperintelligenz folgen können. Wir leiten Sie mit gezielten Trainings- und Coachingmethoden an, in der Familie zurück zu einem intuitiven Essverhalten zu finden.
Oder wir unterstützen Sie frühzeitig, damit Ihr Kind seine Körperintelligenz und sein natürliches Gespür für ein gesundes Essverhalten erst gar nicht verliert.

Vertrauen schenken
Wissenschaftlich ist bewiesen, dass es Kinder innerlich stark macht, wenn wir ihnen als Eltern Vertrauen schenken. Selbstvertrauen erwächst aus dem Vertrauen, das wir ihnen entgegenbringen.
Oft fällt es schwer, die Kontrolle abzugeben. Hier ist es hilfreich, die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen und Schritt für Schritt umzukehren. Dabei begleiten wir Sie.

Achtsamkeit und Empathie leben
Oft greifen Kinder nicht aus Hunger, sondern aus Frust, Traurigkeit oder Langeweile zum Essen. Das hat nichts mit ungesunder Ernährung zu tun, es ist vielmehr darin begründet, dass andere Bedürfnisse nicht erfüllt sind.
In Kontakt mit Ihrem Kind zu treten und es vor emotionalem Essen zu schützen – dabei unterstützen wir Sie.
Meinungen



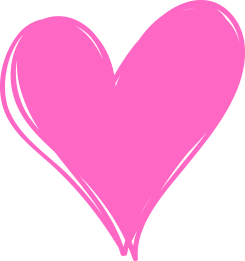 schlägt.
schlägt.


































